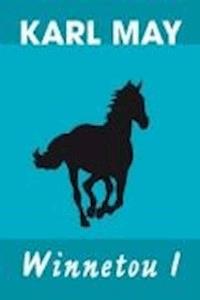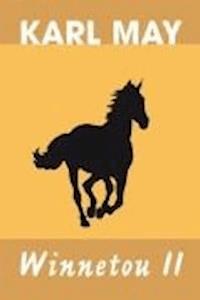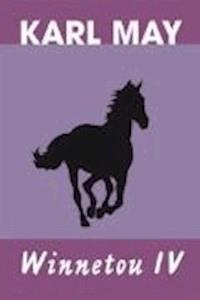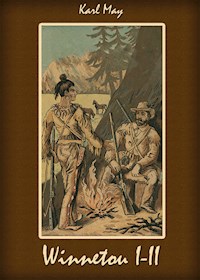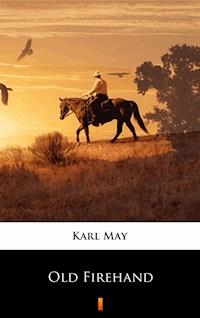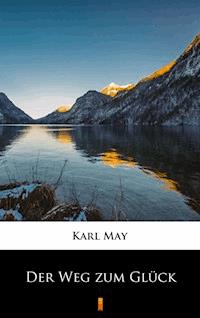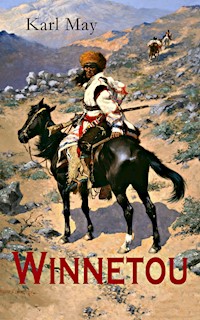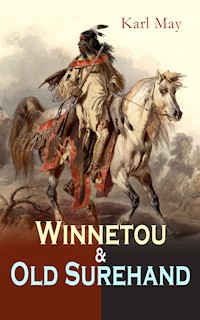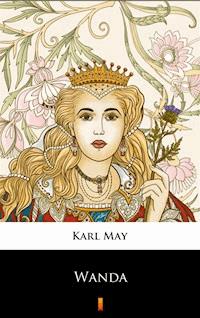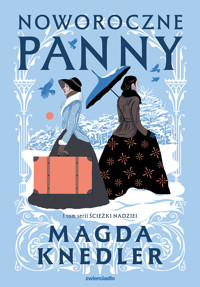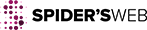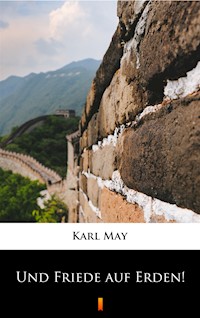
14,90 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: KtoCzyta.pl
- Kategoria: Powieści przygodowe i historyczne
- Język: polski
Und Friede auf Erden! ist Band 30 von Karl Mays „Gesammelten Werken”, ist eine Reiseerzählung. Das Buch entstand unter dem unmittelbaren Eindruck von Karl Mays großer Orientreise 1899 – 1900. „Und Friede auf Erden! „ gehört zu den interessantesten Werken von Karl May und spielt in China. In Kairo lernt der Erzähler seinen zukünftigen Diener Sejjid, den religiösen Fanatiker Waller und dessen Tochter, sowie zwei Chinesen kennen. Nach ersten Abenteuern in Gizeh beschliessen die fünf Reisenden, gemeinsam weiterzuziehen. Über Ceylon, die malaiische Halbinsel und Penang führt sie der Weg bis nach China.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 871
Podobne
Karl May
Und Friede auf Erden!
Warschau 2019
Inhalt
Erstes Kapitel. Ein Eiferer.
Zweites Kapitel. Civilisatoren.
Drittes Kapitel. Die „Shen“.
Viertes Kapitel. Wahnsinn.
Fünftes Kapitel. Der Shen-Ta-Shi.
Erstes Kapitel. Ein Eiferer.
„Ich bin Sejjid Omar!“
Wie stolz das klang, und wie beweiseskräftig die Gebärde war, mit welcher er diese Worte zu begleiten pflegte! „Ich bin Sejjid Omar,“ das sollte sagen: „Ich, Herr Omar, bin ein studierter, schriftkundiger Abkömmling des Propheten, welcher der Liebling Allahs ist. Mein Name wurde mit allen meinen persönlichen Vorzügen in die heilige Stammrolle zu Mekka eingetragen; darum habe ich das Recht, ein grünes Oberkleid und einen grünen Turban zu tragen. Wenn ich sterbe, wird die Kuppel meines Grabmals grün angestrichen und mir die Tür des obersten der Himmel gleich geöffnet sein. Respekt also vor mir!“
Was aber war dieser Sejjid Omar? Ein Eselsjunge! Er hatte seinen „Stand“ an der Esbekije in Kairo, dem Hotel Kontinental, in welchem ich wohnte, gegenüber. Ein schön und kräftig gebauter, junger Mann von wenig über zwanzig Jahren, war er mir durch seinen steten Ernst und die angeborne Würde seiner Bewegungen aufgefallen. Ich beobachtete ihn gern von meinem Balkon aus, und wenn ich unten auf dem prächtigen Vor- platze des Hotels meinen Kaffee trank, konnte ich ihn sprechen hören. Sein Gesicht zeigte zwar auch den Zug von Verschlagenheit, der allen Eseltreibern eigen ist, aber er war nicht aufdringlich und lag seinem Geschäfte in einer Weise ob, als werde Jedem, der sich seines Esels bediente, eine ganz besondere Gunst erwiesen. Er gab sich so wenig wie möglich mit Berufsgenossen ab, und wenn sie ihn für diese Zurückhaltung mit spöttischen Redensarten zu ärgern versuchten, bekamen sie nichts als ein verächtliches „Ich bin Sejjid Omar“ zu hören. Wollte ein Fremder mit ihm feilschen, oder wurde ihm irgend Etwas gesagt oder zugemutet, was er für gegen seine Ehre hielt, so wendete er sich mit einem geringschätzenden „Ich bin Sejjid Omar“ ab und war dann für den Betreffenden nicht mehr zu sprechen.
Die Folge war, daß ich ihm ein ganz besonderes Interesse schenkte, obgleich sich mir keine Gelegenheit bot, ihm dies in Beziehung auf sein Geschäft zu beweisen[.] Aber Blicke ziehen einander bekanntlich an. Ich bemerkte, daß auch er sehr oft zu mir herübersah. Er schien unruhig zu werden, wenn ich nach dem Mittag- und dem Abendessen mich nicht sofort auf der Terrasse sehen ließ, und sooft ich beim Ausgehen an ihm vorüberkam, trat er, obgleich ich ihn gar nicht zu beachten schien, einen Schritt zurück und legte, still grüßend, die Hände auf die Brust.
In dem erwähnten Hotel gibt es zu Seiten des Speisesaales zwischen den Säulen kleinere Tische für Gäste, welche es nicht lieben, an der Tafel enggepfercht zu sitzen. Ich hatte mir einen dieser Tische für mich allein reservieren lassen. Der links davon war nicht besetzt; an dem zu meiner rechten Hand gab es seit gestern zwei Fremde, welche nicht nur die allgemeine Aufmerksamkeit, sondern auch die meinige auf sich zogen, obgleich ich mir das nicht so wie die Andern merken ließ. Sie waren Chinesen, und zwar Vater und Sohn. Ich erriet das zunächst aus ihrer Aehnlichkeit und hörte es dann aus ihrem Gespräch, denn ihr Tisch stand dem meinen so nahe, daß ich jedes ihrer Worte verstehen konnte. Sie waren nicht in heimische Tracht gekleidet, sondern trugen weiße Reiseanzüge nach französischem Schnitte. Ihre Zöpfe wurden von den Tropenhelmen verborgen, die sie nur während der Tafel abzunehmen pflegten. Gleich als sie gestern den Speisesaal betraten, war mir die ebenso tiefe wie herzlich aufrichtige Ehrerbietung aufgefallen, welche der Sohn dem Vater entgegenbrachte. Das war eine geradezu rührende Aufmerksamkeit und Dienstfertigkeit, welche sogar dem servierenden Kellner jede Handreichung und jeden Griff abzunehmen strebte, um dem Vater Kindesdank und Kindesliebe zu erweisen. Und man sah deutlich, daß dies nichts Gemachtes, nichts Aeußerliches war, sondern als etwas frei und gern Gegebenes aus dem Innern kam. Der Vater trug Augengläser in schwer goldenem Gestell; der Sohn hatte keine Brille. Sie speisten genau nach unserer Art und taten dies so geläufig und so fehlerlos, so unhörbar und unauffällig, daß manche der übrigen Gäste sich an ihnen hätten ein Beispiel nehmen können. Der mich bedienende Garçon flüsterte mir in Hoffnung auf ein dafür gebotenes Extratrinkgeld zu:
„Monsieur Fu und Monsieur Tsi aus China. Kommen aus Paris. Sind wahrscheinlich verwandt miteinander.“
„Haben sie sich selbst so eingetragen?“ erkundigte ich mich.
„Nein, aber dem Portier so gesagt.“
Er sprach die beiden Worte nicht in der richtigen Weise aus; aber es war klar, daß Fu Vater und Tsi Sohn bedeutete. Im Chinesischen hat dasselbe Wort oft sehr verschiedenen Sinn. Die beiden Gäste hatten ihre Namen nicht genannt und sich einfach als Vater und Sohn bezeichnet. Da hier im Hause Niemand ihrer Sprache mächtig war, so hatte man sie als Monsieur „Vater“ und Monsieur „Sohn“ in das Fremdenbuch eingetragen und glaubte noch besonders pfiffig zu sein, indem man sie für Verwandte hielt. Sie aber ließen es sich lächelnd gefallen, daß ihr Verwandtschaftsgrad als Namen ausgesprochen wurde. Dem Personale gegenüber sprachen sie französisch, und zwar so vorzüglich, daß eine langjährige Uebung mit Gewißheit anzunehmen war.
Was ihre Gesichter betrifft, so trat der mongolische Schnitt derselben nur wenig hervor. Bei dem Sohne mochte diese Milderung eine Folge der Jugend sein; bei dem Vater aber war es ganz entschieden der Wirkung geistiger Tätigkeit zuzuschreiben, daß ihn fast nur der echt chinesisch gepflegte Bart als einen „Sohn der Mitte“ verriet. Man brauchte kein Menschenkenner zu sein, um diesem Manne anzusehen, daß sein Arbeitsfeld wohl kaum jemals ein materielles gewesen sei.
Nach Tische wurde draußen im Flur während des allgemeinen Speech die Tatsache festgestellt, daß die beiden Chinesen erstens aus Canton, zweitens Onkel und Neffe und drittens in Paris gewesen seien, um dort ein Geschäft für Chinawaren einzurichten, dessen Leitung der Neffe übernehmen werde. Er habe den Onkel nur nach Aegypten zurückbegleitet, um die Trennung zu verzögern, werde aber hier von ihm Abschied nehmen und dann, direkt nach Paris zurückkehren. Es war mir gleichgültig wer diese Entdeckung gemacht hatte. Ich konnte mir nicht denken, daß dieser so eigenartig, ich möchte sagen, geheimnisvoll geistreich aussehende „Monsieur Fu“ ein Kaufmann sei, dessen Bestreben darin bestehe, billige chinesische Fächer und Vasen in Paris teuer an den Mann zu bringen.
Der Zufall war so gütig, mich schon am nächsten Morgen einen heimlichen Blick in diese Verborgenheit tun zu lassen. Ich logierte, um möglichst viel Luft und Licht zu haben, zwei Treppen hoch und saß, mit Briefen beschäftigt, auf dem Balkon, als ich die Chinesen aus dem Hotel treten und hinüber zu Sejjid Omar gehen sah. Dieser besorgte ihnen zu seinem noch einen zweiten Esel, worauf er mit ihnen davontrabte. Dann hörte ich unter mir klopfen und bürsten. Das störte mich und wollte kein Ende nehmen. Ich bog mich über die Brüstung vor und schaute hinab. Es war nicht, wie ich vermutet hatte, das Zimmermädchen, sondern ein chinesischer Diener, welcher einen Koffer geöffnet hatte, um den Inhalt desselben einer Besichtigung resp. Säuberung zu unterwerfen. Die Chinesen wohnten also eine Treppe hoch grad unter mir. Ich ließ den Mann weiter klopfen und bürsten, ohne den Attentäter, was ich eigentlich beabsichtigt hatte, zur Ruhe zu verweisen.
Dann wurde es still unter mir, doch verriet mir wiederholtes Räuspern, daß der Diener noch da sei. Ich schaute wieder hinab. Er war jetzt mit einem andern, kleinen Koffer beschäftigt, den er geöffnet hatte. Er ordnete da verschiedene Gegenstände mit einer Behutsamkeit, die auf ungewöhnlichen Wert schließen ließ, und versicherte sich von Zeit zu Zeit durch einen Blick nach den benachbarten Balkonen, daß er nicht beobachtet werde. Der Inhalt dieses Koffers schien also Dinge zu enthalten, von denen nicht Jedermann wissen durfte. Eben jetzt hatte er einen Gürtel in der Hand, an welchem eine goldene, mit Rubinen besetzte Schnalle glänzte. Diese Art von Schnallen dürfen nur Mandarinen ersten und zweiten Ranges tragen! Dann sah ich ein Putsu erscheinen, dessen Stickerei einen Storch vorstellte. Nach einer Kugelkette, einer Pfauenfeder und verschiedenen anderen Gegenständen, welche ich wegen ihrer Kleinheit nicht deutlich erkennen konnte, kam einer jener Beamtenhüte zum Vorschein, welche nur im Sommer getragen und darum „warme“ Hüte genannt werden. Er hatte einen glatten, roten, ungeblümten Korallenknopf. Kugelketten dürfen nur von Mandarinen ersten bis fünften Grades um den Hals getragen werden. Pfauenfedern sind besondere Auszeichnungen; aber der Korallenknopf ist nur den Mandarinen ersten Ranges erlaubt. Diese sind entweder Zivil- oder Kriegsmandarinen. Die ersteren haben ein Putsu mit Storch, die letzteren ein dergleichen Schild mit dem Bild des Einhorns zu tragen. Die Zivilbeamten werden mehr als die militärischen geehrt. Ich hatte also erfahren, daß „Monsieur Fu“, denn nur auf ihn konnten sich diese Auszeichnungen beziehen, ein Zivilmandarin allerhöchsten Ranges war, und nahm mir selbstverständlich vor, dies keinem Menschen mitzuteilen. Mehr zu sehen, wurde mir durch meinen Bleistift unmöglich gemacht. Ich hatte ihn hinter das Ohr gesteckt; er verlor dadurch, daß ich den Kopf vor und nach unten gebeugt hatte, den Halt, fiel hinab und traf grad vor dem Diener auf das Balkongeländer auf. Der Chinese stieß einen Ruf des Schreckens aus, raffte Alles schnell zusammen und war im nächsten Augenblicke ver- schwunden. Auch dieser sein Schreck war ein Beweis, daß seine beiden Herren ihren Stand nicht zu verraten wünschten.
Wir befanden uns im Vorsommer, also in der Zeit, in welcher der Khamsin jährlich gegen fünfzig Tage lang der höchst ungern gesehene Gast Aegyptens ist. Dieser heiße, trockene Südwestwind, welcher den feinen Staub der Wüste mit sich führt, kann, wenn er stark auftritt, so erschlaffend wirken, daß sowohl der Einheimische als auch der Fremde Alles meidet, was mit einer körperlichen Anstrengung verbunden ist. Am Tage nach der soeben erzählten Entdeckung wehte er ganz besonders entkräftend von Gizeh und Aryahn herüber. Man mied die Straßen, und die sonst so gern besuchten Plätze vor den Kaffeehäusern waren noch um die Zeit des Asr, des täglichen Nachmittagsgebetes, unbesetzt. Dies veranlaßte mich, nach dem Dschebel Mokattam zu reiten. Ich war den Khamsin längst gewohnt; er konnte mich nicht belästigen und hielt im Gegenteile andere Leute ab, mich da oben in dem mir liebgewordenen Genuß zu stören. Der Blick vom Mokattam und dem Dschebel Giyuschi ist unbeschreiblich schön, mir aber doppelt wert, wenn beim Sonnenuntergange die Beleuchtung der Stadt und ihrer Umgegend durch den in der Luft schwebenden Khamsinstaub zu einer, fast mochte ich sagen, märchenhaften wird. Es sind dann alle Härten und Schärfen des Bildes abgemildert, und es liegt ein so undefinierbarer Farbenton rings ausgegossen, daß man meinen möchte, von einer jenseitigen Höhe auf eine ganz andere, un- oder überirdische Welt herabzuschauen.
Eben als ich mich aufmachte, brachte der Kommissioner des Hotels einige Wagen voller Reisende, welche mit dem Zuge angekommen waren. Ich hatte keinen Grund, sie zu beachten, doch fiel mir im Vorübergehen eine junge, blau verschleierte Dame auf, welche einfach in Grau und praktisch knöchelfrei gekleidet war und zu einem mit ihr ausgestiegenen Herrn einige englische Worte sprach. Ich hatte nur selten eine so tiefe, wohlklingende und sympathische Altstimme gehört.
Dann saß ich oben auf dem Berge, in stiller, zunächst ununterbrochener Einsamkeit. Mein Lieblingsplatz war ein Felsensitz in der Nähe der alten, verfallenen Giyuschi-Moschee. Die Sonne hielt sich hinter einem flimmernden, orangefarbenen Dufte halb verborgen. Wie ein im Einschlummern unvollendet gebliebenes Gebet lagen die Mamelukengräber tief zu meinen Füßen. Von der Alabastermoschee bis nach Kasr el Ain hinüber und von der ahnenhaften Amr Ibn el As bis zur früheren ez Zahir hinunter klangen die in Stein gedichteten tausend Strophen der Minarehs zu Allahs Thron empor. Durch Masr el Atika, das einstige Fostat, dampfte, einer Entheiligung gleich, ein Zug hinauf nach Heluan, und hinter den Lebbachbäumen der Dakrurstraße und dem Grün der Kanalfelder lagen am Wüstenrande die Pyramiden – – aus Angst vor der Ewigkeit erstarrte Todesgedanken der Pharaonen. Tod und Leben, Vergangenheit und Gegenwart um und in sich vereinigend, vom Wüstenwind überweht und doch so jugendschön und jugendwarm, so breitete sie sich vor meinen Augen aus, El Kahira, die Siegreiche, die mir nebst Bagdad und Damaskus so lieb geworden ist wie keine andere Stadt des Orientes.
Es kamen von da unten herauf, von den Königsgräbern da drüben und dem Sinai im Osten hinter mir Gedanken über mich, welche ich nicht verloren gehen lassen wollte; darum zog ich Papier und Blei hervor. Ich begann damals, an meinen „Himmelsgedanken“ zu dichten, deren erster Band inzwischen erschienen ist. Dieses Buch war auch einer der Gründe, welche mich zur gegenwärtigen Reise veranlaßt hatten. Wer Gedichte über und für die Menschheitsseele schreiben und den Völkern gerecht werden will, denen diese Seele ihre Jugendbegeisterung widmete, der darf nicht meinen, daß er die Gedanken dazu im kalten, selbstsüchtigen Abendlande finden werde, sondern er muß dorthin gehen, wo einst Gott selbst zur Erde kam und seine Engel sich den Menschen zeigen durften, ohne, wie es allerdings ein einziges Mal, und zwar zu Sodom und Gomorrhas Verderben geschah, für ihre Himmelsliebe schlimmen Erdendank zu ernten.
Da, wo die nackt gewordenen Steine Palästinas wieder zu Brot zu werden haben, wo Memnons Kolosse nicht nur leise erklingen, sondern deutlich sprechen sollen, wo zwischen Pison, Gihon, Phrat und Hidekel noch heut die beseligende Idee des Paradieses wieder auszugraben ist, da muß man sein, da muß man sehen und lauschen, äußerlich und innerlich, und dann, wenn in stiller Mondesnacht aus den Wogen des Niles ganz dieselbe Offenbarung wie aus den Fluten des Tigris steigt und um die Minarehs dasselbe linde Säuseln klingt, welches Elias einst auf dem Karmel hörte, dann wird es der Menschenseele klar, daß auch ganz dieselben Strophen wieder zu ertönen haben, welche der Orient einst zu dichten begonnen, der Occident aber als Hoheslied der Gottes- und der Nächstenliebe zu vollenden hat.
Es war mir eine Lust, diese und ähnliche Gedanken in Worte zu kleiden; aber ich brachte es zu keinem Schlusse, denn ich wurde unterbrochen. Vom Felsenwege her erklang das lebhafte Getrappel kleiner Eselshufe. Mich umschauend, sah ich die erwähnte, grau gekleidete Dame und den Herrn kommen, mit welchem sie gesprochen hatte. Als dritten Reiter bemerkte ich einen jener christlichen oder jüdischen Levantiner, welche jedes von ihnen gehörte, wenn auch gänzlich unverstandene, fremdsprachige Wort in dem Mehlwürmertopfe ihres Gedächtnisses sorgfältig aufbewahren, um sich dann, wenn sie mit diesen Würmern nicht mehr allein fertig werden können, für Dolmetscher auszugeben und sie gegen möglichst hohe Vergütung an den Mann zu bringen. Diese Dragomans sind eine Plage, welcher sich zu erwehren der gewöhnliche Tourist weder genug Erfahrung noch die nötigen Kenntnisse besitzt. Wenn sie sich einmal festgesogen haben, so lassen sie nur selten wieder los, und der von ihnen, den ich hier kommen sah, war eine Klette von der allerschlimmsten Sorte. Er hatte sich vor einigen Tagen auch an mich zu machen versucht, war aber, als nichts Anderes half, durch einen Wink mit der Reitpeitsche dann für immer abgewiesen worden. Diese Levantiner werden von dem ehrlichen, charaktervollen Araber verachtet, und da sie meist Christen sind und er durch sein eigenes Leben belehrt wird, welchen großen Einfluß der Glaube auf den moralischen Wert des Menschen ausübt, so ist er leicht geneigt, nicht bei der Person stehen zu bleiben, sondern seine Geringschätzung über die ganze Christenheit auszudehnen.
Die vierte Person war – – – Sejjid Omar, der Eseltreiber, welcher so gravitätisch, als ob er die Hauptperson der ganzen Truppe sei, neben den Dreien hergeschritten kam.
Als der Dolmetscher mich erblickte, kam er grad auf mich zugeritten, stieg bei mir ab und breitete eine mitgebrachte Decke neben mir aus. Er hatte, als er sich mir anbot, französisch mit mir gesprochen; warum, das wußte ich nicht, sollte es jetzt nun aber erfahren, denn er rief, sich umdrehend, Sejjid Omar zu:
„Dieser Kerl sitzt gerad an der besten Stelle! Er ist ein Franzose, denn er hat ein Bärtchen an der Unterlippe. Komm her, und jag ihn fort!“
„Nimm dich in Acht!“ warnte der Eseltreiber. „Wenn er arabisch sprechen kann, versteht er deine Worte!“
„Der? Arabisch sprechen? Siehst du denn nicht, daß ihm die Dummheit aus den Augen blickt? Der spricht nicht einmal seine Muttersprache richtig. Ich weiß das ganz genau, denn ich habe französisch mit ihm geredet. Er wollte mich als Dolmetscher haben; ich bin aber nicht darauf eingegangen, weil ich ihm sofort angesehen habe, daß er ein armer Schlucker und außerdem ein Geizhals ist. Jage ihn fort! Wir brauchen diesen Platz für unsere Leute!“
Da machte der Sejjid eine seiner unnachahmlichen, sprechenden Handbewegungen und antwortete:
„Ich bin nicht dein Diener, und Allah und mein Geschäft verbieten mir, unhöflich zu sein. Wenn du als Christ und Grieche grob sein darfst, so geht mich das nichts an. Ich heiße Sejjid Omar; das merke dir!“
Der Levantiner hätte es vielleicht gewagt, aus Rachsucht mit Hilfe des Eseltreibers mit mir anzubinden; aber es ohne diese Unterstützung zu tun, dazu war er, wie die meisten seinesgleichen, zu feig. Er hatte, nur um mich zu ärgern, die Fremden grad her zu mir geführt, obgleich ich vor ihnen der einzige Mensch war, der sich auf dem weiten Plateau des Dschebel Giyuschi befand, auf welchem Platz für ungezählte Tausende gewesen wäre. Ich aber tat, als ob mir diese Flegelhaftigkeit vollständig gleichgültig sei.
Der Hammahr half den Reisenden beim Absteigen. Dann setzten sie sich auf die ausgebreitete Decke, ohne mich zu grüßen oder auch nur mit einem Blicke zu beachten. Das beleidigte mich nicht. Ich kannte ja diese besonders jenseits des Kanales und des Atlantischen Meeres gepflogene Weise, nach welcher fremde Menschen als vollständig abwesend betrachtet werden. Selbstverständlich waren sie nun auch für mich nicht vorhanden, und ich rauchte die Zigarre, welche ich mir angebrannt hatte, ruhig weiter, obgleich ich sah, daß der Wind der Dame den Rauch zuweilen in das Gesicht trieb. Sie saß mir so nahe, daß ich sie mit der ausgestreckten Hand erreichen konnte.
Nun stellte sich der Dolmetscher in Positur und begann, den Fremden das vor ihnen liegende Panorama zu erklären. Er tat dies in einem Englisch, mit welchem ein Bauer, ohne die Hacke nötig zu haben, die stärksten Rüben hätte aus dem Felde ziehen können, und es war den beiden Zuhörern auch mehr als deutlich anzusehen, daß sie sich von dem, was sie anhören mußten, nichts weniger als erbaut fühlten. Eine Weile ließen sie es sich gefallen, dann aber gebot die Dame dem poliglott-schrecklichen Griechen, still zu sein, zog ein rotgebundenes Buch aus der Tasche und sagte zu dem Herrn, zu meiner Ueberraschung in deutscher Sprache:
„Verstehst du ihn, Vater? Ich nicht! Nehmen wir den Baedeker her! Die Karte wird uns mehr sagen, als wir von diesem Araber erfahren können. Und reden wir deutsch, denn das versteht er nicht!“
Der für einen Araber Gehaltene zog sich beleidigt zurück. Gerade diese unwissenden Menschen sind außerordentlich empfindlich, wenn man ihren vermeintlichen Kenntnissen nicht die erwartete Bewunderung zollt. Sejjid Omar stand, mit dem Ellbogen auf seinen Esel gestützt, unbeweglich wie eine Bildsäule seitwärts hinter uns. Der lange, weite Mantel, den er trug, war nicht imstande, die schöne Plastik seiner Figur ganz unbemerkbar zu machen.
Ich hatte also erfahren, daß die Fremden Vater und Tochter seien. Ich erfuhr noch mehr. Ob sie mir die Kenntnis der deutschen Sprache nicht zutrauten, oder ob ihnen meine Anwesenheit wirklich vollständig gleichgültig war, sie sprachen so ungeniert miteinander, als ob an meiner Stelle nichts als Luft vorhanden sei.
Der Vater war ein ziemlich langer, hagerer Herr mit einem glattrasierten, etwas mehr als nötig in die Länge gezogenen Gesicht. Der Stehkragen seines Rockes paßte zu der salbungsvollen, dabei aber harten und schnellen Weise, in welcher er sprach. Er hatte einen seiner Handschuhe ausgezogen, was mir Gelegenheit gab, seine auch sehr lange, doch weiße und sichtbar wohlgepflegte Hand zu sehen. Nicht angenehm berührte der rücksichtslose, schnarrende Ton, in welchen er fiel, so oft es seine Absicht war, eine bestimmte Meinung auszusprechen. Ich pflege über andere Menschen nicht vorschnell zu urteilen, doch war ich, obgleich ich diesen Mann heut zum ersten Male sah und ihn also noch gar nicht kannte, zu der Behauptung geneigt, daß er von einer einmal gefaßten, wenn auch noch so falschen Ansicht nicht leicht abzubringen sei. Vielleicht war er sonst ein ganz vorzüglicher Mann, aber er machte den Eindruck auf mich, als ob er sich für unfehlbar halte, und mit solchen Leuten ist schwer umzugehen.
Die Tochter wurde von ihm Mary genannt. Sie hatte, um besser Umschau halten zu können, den Schleier zurückgeschlagen. Ich hütete mich natürlich, meine Beobachtungen merken zu lassen, doch genügte ein kurzer Blick, mich ein liebes, rosig angehauchtes Gesicht sehen zu lassen, in welchem ein Paar helle, klare, sehr verständige Augen glänzten. Ihre tiefe, schöne Altstimme habe ich schon erwähnt. Wenn sie sprach, so war ihr anzuhören, daß sie es nicht mit dem Munde, sondern mit der Seele tat. Es klang ganz so, als ob über diese Lippen nie ein liebloses Wort gekommen sei oder kommen könne. Vom Vater hatte sie das nicht geerbt; es konnte nur die Gabe einer vortrefflichen, an Herzensbildung reichen Mutter sein.
Der Vater war Amerikaner, und zwar Missionar, nach China bestimmt, wohin die Tochter ihn begleitete; die Mutter war tot, eine Deutsche gewesen, wie es schien. Sie waren über London, Köln, Wien und Triest nach Aegypten gekommen, um einige Zeit hier zu bleiben und sich dann zunächst Indien anzusehen. Große Eile schienen sie nicht zu haben.
Sie kannten die Wirkung des Khamsin noch nicht und waren trotz desselben gleich nach ihrer Ankunft hier herauf geritten, weil Mary gewünscht hatte, zunächst das Gesamtbild von Kairo vor sich zu sehen. Und der Eindruck desselben war, wenigstens bei der Tochter, ein so tiefer, daß der ermattende Wind auf sie ohne sichtbare Wirkung blieb.
Sie hatte die entfaltete Karte auf ihrem Schoße liegen, ohne aber zunächst nach speziellen Punkten zu suchen. Es schien ihr vor allen Dingen um den Totaleindruck zu tun zu sein. Dabei machte sie dann und wann eine Bemerkung, die mich aufhorchen ließ. In diesem Mädchen schien ein seltsames, ungewöhnlich reiches Seelenleben zu pulsieren! Einmal hätte ich beinahe verraten, daß ich ihr aufmerksam zuhörte. Sie nannte nämlich meinen Namen.
„Weißt du, Vater, an wen ich jetzt denke?“ sagte sie. „An Karl May. Ich habe seine drei Bände ‚Im Lande des Mahdi“ gelesen, und – – – “
„Lies nicht das dumme Zeug von diesem May!“ unterbrach er sie rasch und schnarrend. „Dieser Schriftsteller hat nichts als Phantasie, und du weißt, daß mir seine weichliche Frömmigkeit widerwärtig ist! Wie kommst du dazu, grad jetzt an ihn zu denken?“
„Er nennt Kairo ‚Bauwaabe el bilad esch schark, das Tor des Orientes", und sagt, dieses Tor sei altersschwach geworden und könne dem Einflusse des Abendlandes kaum mehr widerstehen. Es wird mir schwer, das zu glauben. Ich habe den Orient noch nicht gesehen, aber ich liebe ihn und wünsche, daß er sich stärker erweisen möge, als zum Beispiel du, Vater, mit so vielen Anderen denkst. Er ist für mich ein schlafender Prinz im stehengebliebenen Saale einer eingefallenen, morgenländischen Königsburg. Seine Bestimmung ist, von einer abendländischen Jungfrau aufgeweckt zu werden. Wenn dann durch Beide der Osten mit dem Westen in selbstloser Liebe vereinigt ist, werden alle Völker der Erde glücklich sein.“
„Du bist eine Träumerin, ganz wie deine Mutter war! Die Wirklichkeit aber sieht ganz anders aus als so ein Märchentraum. Das Morgenland hat uns um das Paradies gebracht; es hat den Erlöser gekreuzigt und bis auf den heutigen Tag niemals erkennen wollen, was zu seinem Frieden dient. Nun kommen wir, die Himmelsboten, ihm diesen Frieden zu bringen. Nimmt es ihn an, so soll es ihn haben; stößt es ihn aber von sich, so wird es trotz aller unserer Mühe nicht zu retten sein. Schau doch hinab und sieh, was zu deinen Füßen liegt! Alles, was da noch orientalischen Ursprungs ist, steht im Begriff, im Schmutze zu versinken. Alles Neue, Praktische und Gute aber hat diese Stadt vom Abendlande bekommen. Dein Karl May, von dem ich sonst nichts wissen will, hat also in diesem einen Falle ausnahmsweise einmal das Richtige gesagt. Ist der Orient der Märchenprinz, von dem du sprachst, so ist es nur uns Sendboten möglich, ihn aus dem Schlafe aufzuwecken. Nur wir allein können ihn erlösen; wir fußen in und auf der Wirklichkeit; deine abendländische Jungfrau aber gehört ins Reich der Phantasie.“
„Phantasie! Das ist vielleicht das richtige Wort,“ lächelte sie. „Es gibt Leute, welche behaupten, daß die Phantasie hellere und schärfere Augen habe als der alterssichtig gewordene Verstand.“
„Willst du mich belehren?“
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.